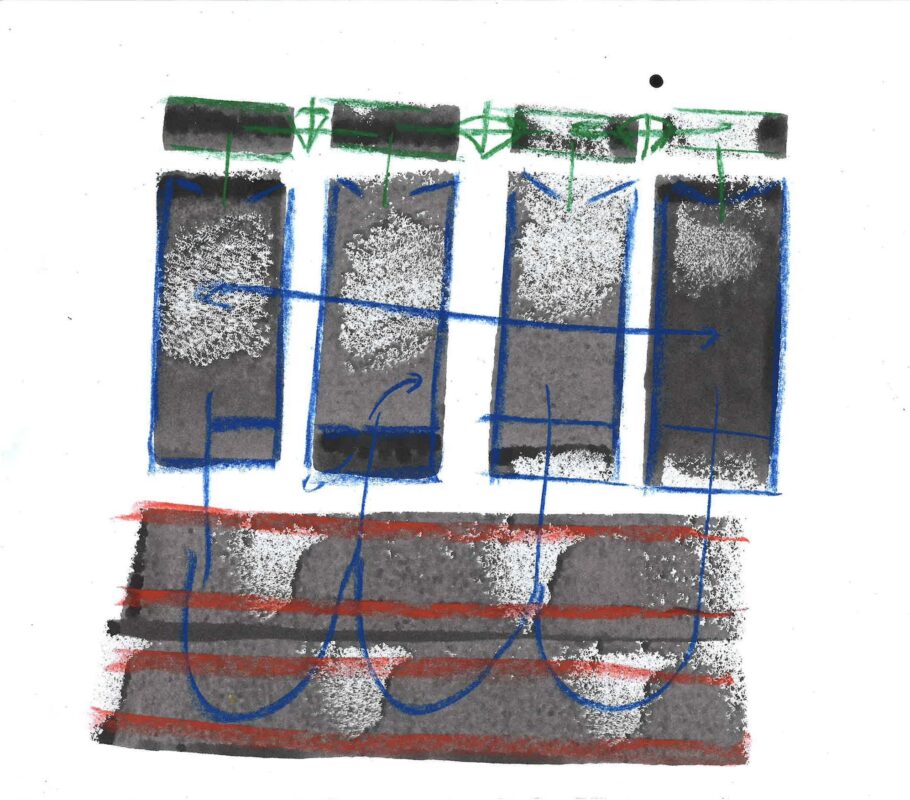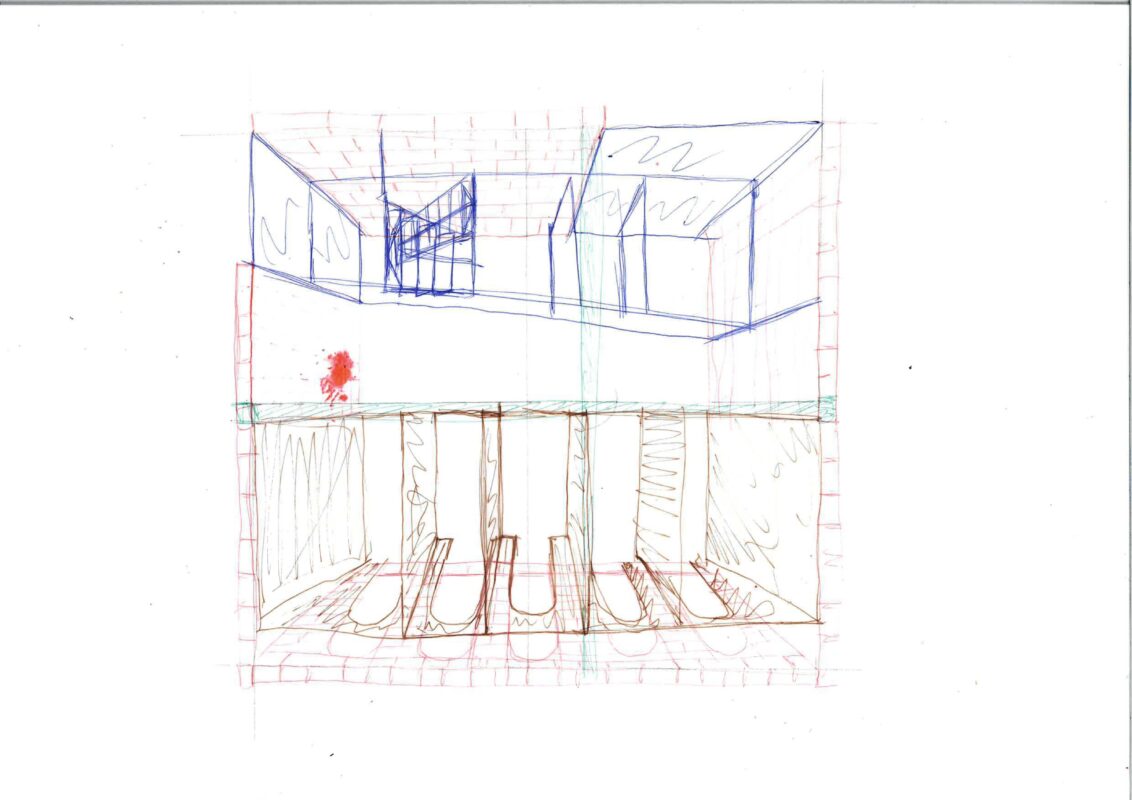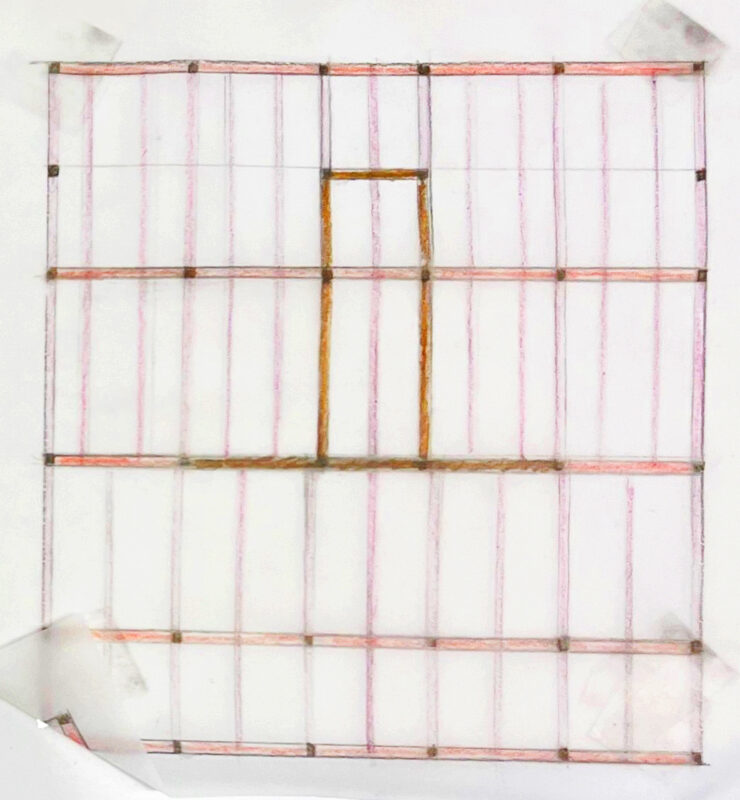Ein Dach für alle┇Sommersemester 2025┇Studio Typologie
Anna Wickenhauser mit Martin Bauer und Jana Riernössl
___________________
Für Gottfried Semper zählte die Wand neben dem Herd, dem Dach und der Substruktur zu den vier Grundelementen des Hauses. Schinkel glaubte an einen textilen Ursprung der Wand: Zwischen Pfosten und Balken eingespannte Stoffe hätten ursprünglich für die Begrenzung des Raums gesorgt, ähnlich den Zelten der Nomaden.
Mit der Sesshaftwerdung der Menschen entstehen unterschiedliche Wohnformen und Wohnkulturen. „Wohnen ist als eine aktive Auseinandersetzung des Menschen mit dem Raum und dessen Einrichtung zu verstehen“, wie die Historikerin Adelheid von Aldern festhält. Aus einfachen Mauern entstehen Wände, indem der Innenraum eines Mauergevierts gestaltet wird und Öffnungen eine Verbindung zwischen dem Innen- und Außen sowie zwischen privaten und öffentlichen Räumen schaffen. Während die Mauer ein eigenständiges Element darstellt, ist die Wand ein relationales Element: Sie ist als Bestandteil des Hauses mit dem Boden und der Decke verbunden und definiert die verschiedenen Räume.
Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Wir alle wohnen, allein oder in Gemeinschaft. Die Entwicklung von einzelnen Räumen mit spezifischen Funktionen, der Trend zur Intimität, das Ansammeln alltäglicher Gegenstände und das Entstehen einer vielfältigen Möbelkultur haben, zusammen mit der städtischen Enge, der Wohnungsnot und dem engen Zusammenleben vieler Menschen aufgrund der Industrialisierung, dazu geführt, dass der früher spärlich eingerichtete Innenraum immer mehr gefüllt wurde.
Erst durch einen Umzug ist man mit dem leeren Wohnraum konfrontiert. Er erscheint wie eine Zelle, ein Gefäß oder eine leere Bühne. Es ist kein Zufall, dass meditative Praktiken, die ursprünglich im Kloster entstanden sind und heute aus fernöstlichen Traditionen übernommen wurden, oft in nahezu leeren Räumen stattfinden. Stille und Licht können den Raum zwischen den vier Wänden so intensiv bereichern, dass das Hocken oder Sitzen darin zu einer angenehmen Erfahrung wird.
Es stellt sich also die Frage, wie viel von dem, mit dem wir uns umgeben, wir wirklich benötigen, und könnten wir unseren Wohnraum nicht auch gemeinschaftlich bewohnen? Wenn Pier Vittorio Aureli darüber in seinem Buch „Less is enough“ schreibt, meint er, dass es bescheidener und vor allem auch mit weniger Raum ginge.
Sollte eine Reduzierung des eigenen Raumbedarfs nicht auch dazu führen, dass daraus alternative Wohnkonzepte gerade im städtischen Raum entstehen könnten? Sollten wir uns nicht auch im Sinne einer Care-Bewegung mit nicht-konformen Menschen zusammenschließen, um Solidarität in der Gesellschaft besser leben zu können? Wie sieht es mit unserem Komfort aus: Brauchen wir wirklich so hohe Standards?
Und sollten wir dabei nicht darauf bedacht sein, diese kollektiven Wohnformen im städtischen Raum durch Nachverdichtungen zu gewinnen?
Mit diesen Fragen werden wir uns entlang der Starhembergerstraße in Linz auseinandersetzen, einem intakten Wohngebiet mit einigen Baulücken, wenigen niedrigen Wohnhäusern und grünen Innenhöfen.
Titelbild: Marie Schöfberger